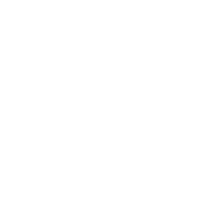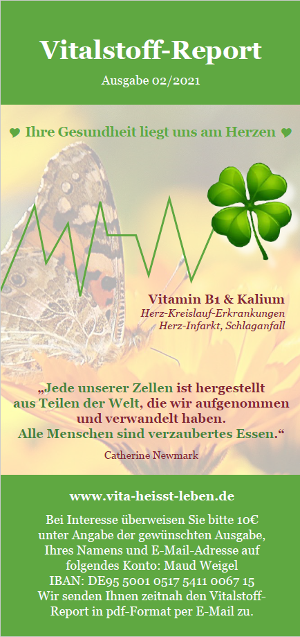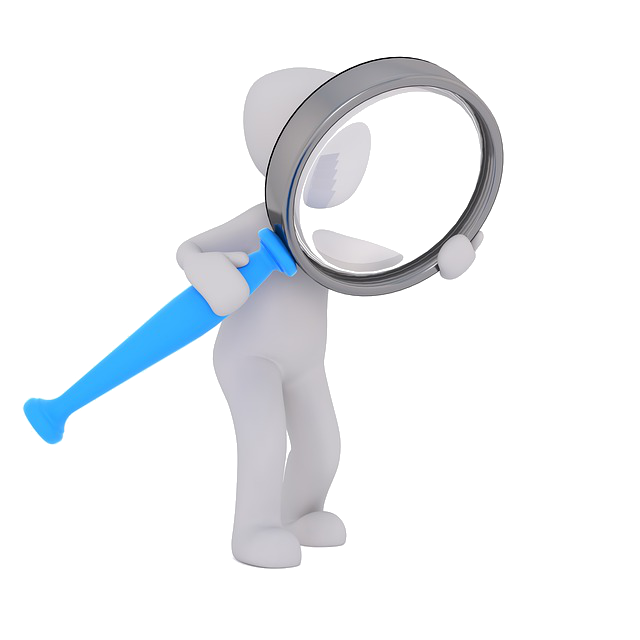Ödemkrankheit (Wassersucht)
Auszüge aus Büchern über Avitaminosen:
"Die Erforschung dieser Krankheit gilt heute (1927!) als abgeschlossen. Besonders betroffen sind Menschen zwischen 50 und 70 Jahren. Bis zur Ausheilung ist körperliche Ruhe erforderlich. Die Ödemkrankheit beginnt mit auffallender Blässe, Kraftlosigkeit, Sinken des Blutdrucks, Verlangsamung des Pulsschlages, teigiger Erschlaffung der Muskeln, Vermehrung des Harndrangs und eventuell einem größeren Wärmebedürfnisses. Oft werden Schmerzen in den Beinen, besonders in den Waden gespürt. Häufig sind auch Kopf- und allgemeine Gliederschmerzen. Der Gang wirkt müde und schleppend. Das Unterhautzellgewebe wird wasserreicher, auch in den Organen und Körperhöhlen sammelt sich Wasser an. Weitere Symptome können sein: Kurzatmigkeit und Herzklopfen bei Bewegung, Nachtblindheit, Einschlafen der Füße, Ameisenkribbeln, Magen- und Darmstörungen. Die Ödeme kommen erst zuletzt, nicht selten ausgelöst durch große körperliche Anstrengung oder einem Infekt. Anfangs besteht sichtbar ein Präödem, welches durch Wassereinlagerungen einen guten Ernährungszustand vortäuscht.
Es kommt am Anfang aber noch nicht zu Herzbeschwerden, der Schlaf ist abgesehen vom häufigen Wasserlassen in der Nacht gut, der Appetit auch. Der Serumeiweißindex ist niedrig, die Haut schlaff, dünn und trocken, sie lässt sich in großen Falten abheben. Nicht selten findet man eine ausgeprägte Furunkulose (schmerzhafte Entzündung des Haarbalgs). Fieber kam nie vor. Die Ödeme setzen plötzlich oder allmählich ein. Zuerst sind meist die Beine geschwollen, öfters auch das Gesicht, besonders die Umgebung der Augen. Gelegentlich zeigen sich Ödeme der Hände. Die Ödeme können hartnäckig oder flüchtig sein. Manchmal genügt ein Tag Bettruhe, um sie zum Verschwinden zu bringen. Bei Wiederaufnahme der Arbeit stellen sie sich oft wieder ein. Mengen von 6 bis 7 Liter Urin am Tag sind keine Besonderheit.
Bradykardie (Herzschlagsfrequenz unter 60 Schlägen in der Minute) und Hypotonie (niedrigen Blutdruck) sind im fortgeschrittenem Stadium charakteristisch. Sie erwecken den Verdacht einer Herzinsuffizienz (Herzschwäche). Kaum ein Patient erreicht einen Pulsschlag von 60 Schlägen in der Minute. Der Herzschlag ist aber völlig gleichmäßig. Es gibt keine Veränderung am Nervensystem. Die Bradykardie ist nur in Ruhe feststellbar. Lässt man den Kranken aufstehen, geht sie schnell in Tachykardie (Herzrasen) über. Ein paar Kniebeuge erhöhen die Pulszahl und nicht selten kommt es zu Dyspnoe (Atemnot) und Cyanose (Blaufärbung der Haut). Die Ursache der Hypotonie ist eine primäre Gefäßschädigung. Das Herz ist so gut wie nie verändert. Vergrößerte Herzen findet man nur bei Komplikationen.
Die Rispirationsorgane (Atmungsorgane) sind unbeteiligt. Darmgeräusche zeugen oft von Gärungsprozessen. Unverdaute Kohlenhydratreste sind in den Stühlen reichlich vorhanden. Es kann zu Durchfällen kommen. Nachtblindheit ist bei Ödemkranken häufig zu beobachten. Blutungen gehören nicht zum Krankheitsbild der Ödemkrankheit. Der Urin ist zucker- und eiweißfrei. Besonders hoch ist die Kochsalzausscheidung, welche 30-50 g täglich beträgt. Es können sogar 150 g täglich sein. Die Farbe des Urins ist hellgelb.
Bei Ödemkranken war die Ernährung reich an Kohlenhydraten, aber arm an Eiweiß und Gemüse. Fette fehlten fast völlig. Alle Kranken hatten eine ungenügende Eiweißaufnahme. Der Eiweißverlust betrifft die Zellen und die Gewebeflüssigkeit. Es wird ein großer Stickstoffhunger beobachtet. Eine Eiweißaufnahme von 100 g am Tag ist für eine gesunde Ernährung nötig. Beim Ödemkranken wurde eine Verarmung an Fettsäuren beobachtet. Dies ist aber nur eins von vielen Mängeln. In der Kost der Ödemkranken haben besonders die Vitamine A und D gefehlt. Das Vitamin C war eher selten. Die Kost der Ödemkranken war mit 25-45 g am Tag kochsalzreich.
Die Nieren von Ödemkranken sind funktionell intakt. Die Ursache der Ödemkrankheit ist extrarenal (außerhalb der Niere) zu suchen, in Veränderungen des Gewebes selbst, der Capillaren und der chemischen und psysiko-chemischen Zusammensetzung der Blut- und Gewebeflüssigkeit. Die Nahrung war reich an Natrium und Kalium, während Calcium stark zurücktrat. Bei den Kranken wurde mehr Calcium ausgeschieden, als mit der Nahrung aufgenommen wurde. Der CaO-Gehalt im Gesamtblut liegt meistens unter 10 mg%. Normal sind 11,5-12,0 mg%. Der Blutkaliumgehalt erweist sich ebenfalls als erniedrigt, so dass eine schwere Störung des Verhältnisses Ca:K für das Blut vermieden zu werden scheint. Der Phosphorstoffwechsel zeigt keine Besonderheit.
Es besteht eine enge Beziehung zwischen dem Calcium und dem Phosphatstoffwechsel. Bei Rachitis ist der Kalkgehalt des Blutes normal, aber es besteht eine Hypophosphatanämie des anorganischen Phosphors. Bei Tetanie ist der Blutkalkspiegel erniedrigt, aber der Phosphatgehalt normal. Der Quotient Ca/P nimmt bei der Tetanie gegen die Norm ab: von 1,95 (normal) auf 1,2. Bei der Ödemkrankheit scheinen ähnliche Verhältnisse wie bei der Tetanie zu bestehen. Es tritt langsam eine zunehmende allgemeine Atrophie (Gewebeschwund) ein. Es fehlen die Vitamine A und D, eventuell auch die B-Vitamine. Es kann Xerosis conjunctivae (trockene Augen) und Hornhautgeschwüren kommen. Osteophathien treten häufig zusammen mit der Ödemkrankheit auf.
Es gibt auch ein Zusammentreffen von Beriberi und der Ödemkrankheit, sowie auch von Skorbut und Ödemkrankheit, wenn die Ernährung nur aus Mehl und Hülsenfrüchten besteht und Fleisch und Fette fehlen. Auch der Mehlnährschaden steht in Verbindung mit der Ödemkrankheit. Tritt die Ödemkrankheit allein auf, fehlen nervöse Erscheinungen. Beim Mehlnährschaden ist die Übererregbarkeit charakteristisch. Die Ödemkrankheit weist einen Mangel an Kalk und Kali neben einem gewaltigen Kochsalzüberschuss auf. Der Mehlnährschaden weist eine hohe Zufuhr von Kali und eine geringe Zufuhr von Kochsalz auf. Ödemkrankheit und Mehlnährschaden weisen gemeinsam einen großen Überschuss an Säuren und Phosphorverbindungen auf. Haferkuren fördern die Ödemkrankheit.
Ödeme entstehen nicht bei einer eiweiß- und fettreichen Kost. Eine eiweißarme Kost kann selbst bei Überernährung dafür sorgen, dass keine Gewichtszunahme ja sogar ein Gewichtssturz erfolgt. Die über längere Zeit fortgesetzte Überfütterung mit kohlenhydratreicher Kost führt zu chronischen Schäden, die auf der hydropigenen (wassersuchtverursachenden) Wirkung der Kohlenhydrate bestehen. Die Folge einer solchen Ernährungsweise ist eine abnorme Wasserretention (Wasseransammlung). Mit einem Überangebot an Mineralien, Eiweiß, Fett und Vitaminen kann man dem entgegenwirken."

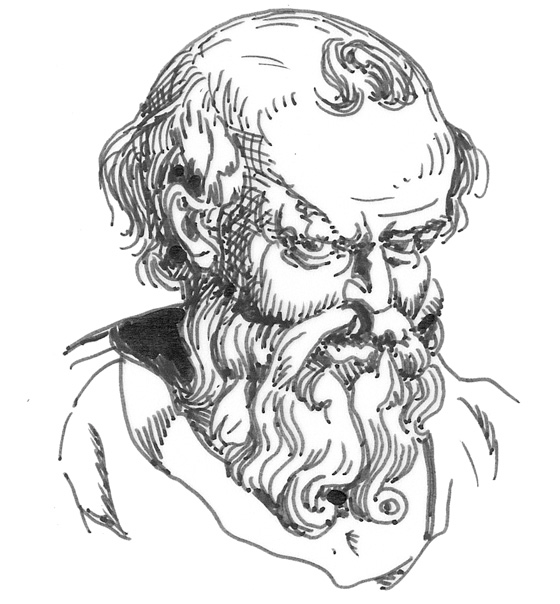 „Da flehen die Menschen die Götter an um Gesundheit und wissen nicht, dass sie die Macht darüber selbst besitzen.“
„Da flehen die Menschen die Götter an um Gesundheit und wissen nicht, dass sie die Macht darüber selbst besitzen.“